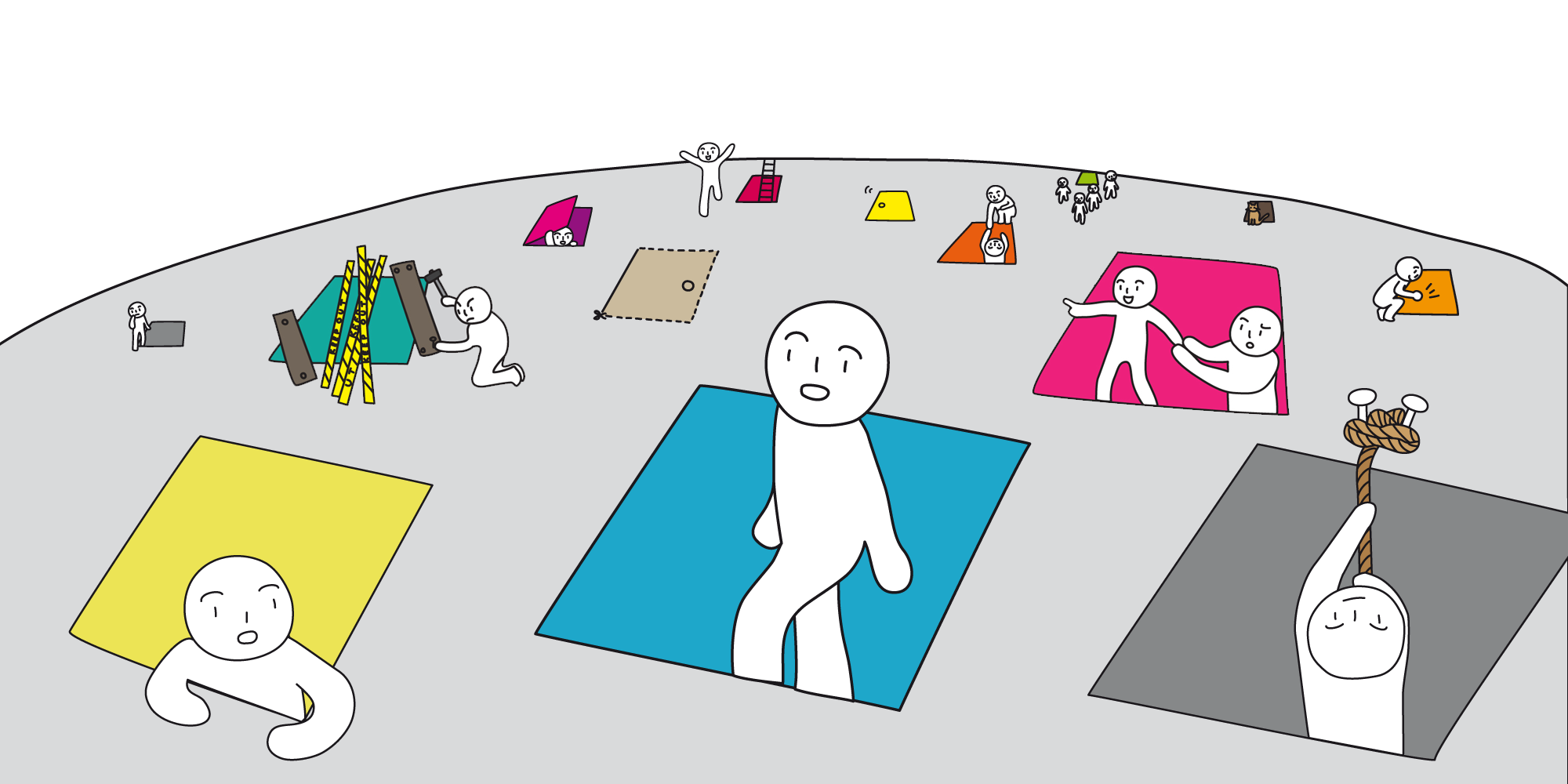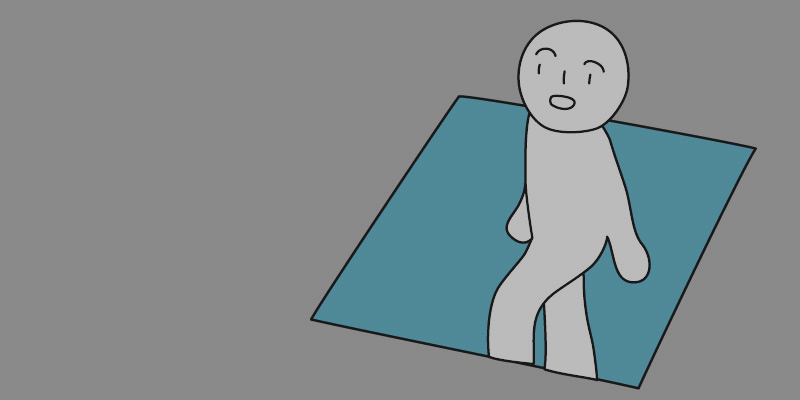Exhibitions, Projects

CAMPUS Exhibition
Bereits seit 2002 veranstalten Ars Electronica und die Linzer Kunstuniversität jährlich eine Ausstellung mit Arbeiten von Studierenden einer internationalen Hochschule, deren Curriculum einen innovativen Ansatz bei der Lehre von Medienkunst und Medienkultur verfolgt. Eine der Aufgaben der Campus-Ausstellung besteht darin, die Arbeiten junger, lokaler MedienkünstlerInnen zu zeigen und ihnen eine internationale Präsenz zu ermöglichen.

Tickle
The Center for Haptic Audio Interaction Research (CHAIR) (DE)
Das Tickle ist ein akustisches Interface für Klang. Es ist das bislang fehlende Eingabegerät für physical modelling Klangsynthese. Vibrationen der Oberfläche werden als Eingangssignal für digitale Resonatoren genutzt. Somit reagiert es natürlich auf Schlagen oder Kratzen, sogar auf das streichen mit einem Geigenbogen. Die Interaktion mit Klang wird dadurch intuitiv und die Kontrolle direkt.

Das ‘Smart’ Unheimliche // The Smart Uncanny
Carlos Orti Roig (ES)
Dieses Projekt untersucht unsere Beziehung zu alltäglichen KI-Elektronikprodukten. Sie stellt die Designtechniken in Frage, mit denen KI-Produkte aus Verbrauchersicht „zuverlässiger“ und „komfortabler“ gemacht werden. Drei KI-Produkte wurden aus einer unheimlichen Perspektive reästhetisiert. Durch das Experimentieren des Publikums mit der „Anti-Alexa Experience“ soll dieses Projekt soziotechnisches Wissen fördern und kritisches Denken gegenüber täglichen KI-Produkten und -Dienstleistungen anregen.

The Messy Shape of Problems – Past, Present and Future Perspectives of Design
Academic Design Network Austria
DesignerInnen müssen sich einem immer komplexeren Feld globaler Herausforderungen stellen und benötigen eine hohe Sensibilität für relevante Fragen, adäquate Ansätze und Werkzeuge, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Wie kann eine Designausbildung die erforderlichen Fähigkeiten und Perspektiven vermitteln, um mit diesem dramatischen Anstieg der Komplexität fertigzuwerden? Und wie gestaltet der technologische Fortschritt die Zukunft des Designs?

Maschine, die auf Gott wartet
Hannes Waldschütz (DE)
Diese Maschine ist Teil einer Serie von drei „wartenden Maschinen“. Sie wurden am 24.10.07 um 18:07 in Bremen aktiviert. Seit diesem Zeitpunkt waren die drei Maschinen durchgehend ohne Unterbrechung bis zu dem von ihnen erwarteten Moment in Betrieb. Die Maschine, die auf Gott wartet ist es noch immer. Sie ist eine mikroelektronische Schaltung, aufgebaut und programmiert, um konstant das erwartete Ereignis abzufragen, ein Signal, das sie durch einen Gottsensor empfängt. Tritt dieses Ereignis ein, hat das ihre automatische Deaktivierung zur Folge. Eine integrierte Notstromversorgung garantiert eine störungsfreie Funktion.

ARS and the CITY
Eine Retrospektive der Aktivität und Wirkung von Ars Electronica in, mit und für Linz: Eine Ausstellung über Kunst-, Medien- und Partizipationsprojekte der Ars Electronica im öffentlichen Raum – von 1979 bis heute.

Queer.net
Archie Wang (CN)
Basierend auf dem Hintergrund der queeren Kultur und inspiriert von verschiedenen Kunstformen, untersucht das explorative interaktive Designprojekt Queer.net, was ein queeres ästhetisches Interface sein könnte. Indem das Publikum die Schnittstelle erforschen kann, zeigt dieses Projekt Möglichkeiten auf, wie queere Interfaces aussehen und was sie ausdrücken könnten. Mit verschiedenen digitalen Medien singt dieses Projekt eine Hymne auf die queere Ästhetik und verschiebt die Grenzen ihrer Anwendungen.

ARS on the WIRE
Lange schon bevor das Internet in Form des WWW eine breite Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen begann und bevor unter dem Begriff „Net Art“ eine junge Generation von KünstlerInnen begann, sich mit den Strukturen, Eigenheiten und künftigen Möglichkeiten dieses neuen Mediums kritisch zu beschäftigen, fanden ab den späten 1970ern vermehrt Telekommunikations-Kunstprojekte statt, die sich mit der globalen Vernetzung auseinandersetzten. Die Ars Electronica war von Anfang an ein Schauplatz für diese zukunftsweisende künstlerische Arbeit.

[burnout] Maschine
Max Kullmann (DE)
Die [burnout]-Maschine wurde entwickelt, um zu verhindern, dass Einzelpersonen (als Teil einer zunehmend gestressten Gesellschaft trotz abnehmender körperlicher Arbeit) ausbrennen, indem sie sich dieser ausschließlich menschlichen Unzulänglichkeit annehmen. Gleichzeitig wird die Beziehung zwischen Mensch und Maschine hinterfragt.

The Life of Crystals
Mónica Bate (CL)
Ausgehend von der Beobachtung piezoelektrischer Kristalle arbeitet das TLC-Projekt an der Schnittstelle von Natur und Technik, Leben und Maschine, Kunst und Wissenschaft. Die Erfahrung zielt auf eine poetisch-technische Neuorientierung ab, bei der diese Materie als natürlich betrachtet werden kann, für die der Mensch eine evolutionäre Rolle spielt.