Kunst verwandelt Unsicherheit in kreative Energie und eröffnet neue Perspektiven auf Gesellschaft und Zukunft. Das Ars Electronica Festival 2025 zeigt, wie künstlerische Arbeiten technologische, soziale und ökologische Umbrüche reflektieren
Viele Künstler*innen suchen bewusst neue Wege, statt an alten Gewohnheiten festzuhalten. Für sie ist Unsicherheit kein Hindernis, sondern eine Quelle der Inspiration. Wandel und Chaos werden nicht gefürchtet, sondern als Chancen genutzt, um neue Ideen zu entdecken und Unerwartetes zu schaffen. Gerade in Zeiten der Verunsicherung, wie sie das heurige Ars Electronica Festival thematisiert, zeigen künstlerische Perspektiven, wie produktiv der Umgang mit dem Ungewissen sein kann.
Das Raqs Media Collective beschreibt es so: Ideen haben selten einen festen Kurs. Sie verändern sich, sobald sie die Welt durchqueren, und können dabei überraschende Richtungen einschlagen. Diese Offenheit macht es möglich, selbst in Zeiten des Umbruchs neue Perspektiven zu gewinnen und Kreativität zu entfalten.
Natürlich können Pläne und Ziele hilfreich sein. Doch in einer Welt, die sich ständig wandelt, dürfen sie nicht zu starren Regeln werden. Mut und Offenheit helfen uns, veraltete Sichtweisen loszulassen und Platz für Neues zu schaffen.

Die Vielfalt der künstlerischen Ansätze ist dabei entscheidend: klare Analysen stehen neben poetischen Momenten, konkrete Konzepte neben kühnen Spekulationen. Kunst schafft Freiräume, in denen wir Zwänge hinter uns lassen, die Welt anders betrachten und Gedanken frei entwickeln können.
Ob Literatur, Bildende Kunst, Musik oder Film – Kunst prägt unser kollektives Gedächtnis, beeinflusst unseren Blick auf die Gegenwart, inspiriert unsere Visionen für die Zukunft und stellt vermeintliche Gewissheiten infrage.
Requiem für die Zukunft
Wir leben in einer Welt, in der wir einen gewissen Handlungsspielraum im Umgang mit Technologien wie KI und Robotik sowie mit wissenschaftlichem Wissen und Daten haben. Künstler*innen fordern uns mit ihren scharfsinnigen Fragen heraus, darüber zu reflektieren. Es stellt sich nicht nur die Frage nach der Rolle als bloße*r Zuschauer*in, sondern auch nach der Vision, mit der sich eine Gesellschaft identifizieren kann – und danach, wie Verantwortung für das Kommende übernommen werden kann.
Die zentrale Ausstellung des Ars Electronica Festivals zeigt jedes Jahr außergewöhnliche Werke, die aktuelle Technologien und gesellschaftliche Fragen aus künstlerischer Sicht beleuchten, mal als Spiegel, mal als Intervention, mal als Vision. Seit 1987 gilt der Prix Ars Electronica als traditionsreichster und bedeutendster Wettbewerb für Medienkunst weltweit und spürt als sensibler Seismograf dem Zeitgeist nach. 2025 gingen fast 4.000 Einreichungen aus 98 Ländern ein. Die ausgezeichneten Projekte, aus den Bereichen New Animation Art, Digital Musics & Sound Art sowie Artificial Life & Intelligence sind während des Festivals im Lentos Kunstmuseum Linz zu erleben.
Die diesjährigen Gewinner*innen loten das Menschsein neu aus: aus einer planetaren Perspektive und mit Zukunftsbildern, die tief in unterschiedliche Kulturen eingebettet sind. Inmitten technologischen Wandels fordern ihre Arbeiten uns heraus, über mögliche Zukünfte nicht nur nachzudenken, sondern aktiv mitzuwirken. Mehr zu den Hintergründen von „Requiem for an Exit“ und den Perspektiven der beiden Künstler erfährst du in unserem Podcast Art is not a thing.

Im Jahr 1817 wagte die Anden-Revolutionsarmee unter dem argentinischen General José de San Martín eine beispiellose Unternehmung: 5.200 Menschen sowie mehr als 10.000 Maultiere und Pferde überquerten die Anden. Ihr Ziel war nichts Geringeres als die Freiheit. Der Marsch über 4.500 Höhenmeter, durch unwirtliches und gefährliches Gelände, wurde zu einem der eindrucksvollsten Kapitel der lateinamerikanischen Unabhängigkeitskämpfe des 19. Jahrhunderts.
Mehr als zwei Jahrhunderte später, im Jahr 2024, machte sich der von der Künstlerin Paula Gaetano Adi entwickelte Roboter „Guanaquerx“ – begleitet von Künstler*innen, Ingenieur*innen, ortskundigen Baqueanos und 58 Maultieren und Pferden – auf, diese historische Route erneut zu gehen. Doch diesmal ging es um eine andere Art von Befreiung: eine technologische Revolution. Als gemeinschaftliches Projekt, das Kunst, Robotik und überliefertes andines Wissen vereint und tief in der Kosmotechnik der Anden verwurzelt ist, wurde Guanaquerx der erste Roboter, der jemals die Anden überquerte und fordert uns dazu auf, Technologien neu zu denken – als Werkzeuge für planetarische Heilung, Befreiung und Widerstand.

Ein etwas anderer Roboter konfrontiert uns in „Requiem for an Exit“ nicht mit Taten, sondern mit Worten. Im Zentrum von Thomas Kvam und Frode Oldereid’s groß angelegte Installation steht ein vier Meter hoher Roboter – armlos, unbeweglich –, dessen Präsenz durch ein hyperrealistisches projiziertes Gesicht und eine durch KI-Synthese und menschliche Performance erzeugte Stimme definiert wird. Die Arbeit suggeriert, dass Gewalt nicht nur kulturell, sondern auch biologisch bedingt sein könnte – in unserer DNA verankert. Das Publikum begegnet einer an Ort und Stelle fixierten Maschine, die in einer dichten, immersiven Klanglandschaft spricht. Ihr Monolog greift historische Gräueltaten auf, von Völkermorden in der Antike über den Holocaust bis hin zu Vertreibungen in der Gegenwart und fragt, ob solche Gewalt eine tragische Ausnahme oder ein wiederkehrendes Muster in der Geschichte der Menschheit ist.
Anstatt die Zukunft vorherzusagen, dient Requiem for an Exit als Nachwort. Es hinterfragt die Mythen des Fortschritts und die Ethik, die wir der Technologie zuschreiben, und deutet an, wie Verantwortung zunehmend an Systeme und Codes ausgelagert wird. Wenn der Roboter verstummt, bleibt eine Konfrontation mit der Vergangenheit, die wir mit uns tragen und mit der Zukunft, die sie weiterhin prägt. Offensichtlich erinnern sich Maschinen an das, was wir lieber vergessen möchten.

XXX Machina ist eine immersive Multimedia-Installation, entwickelt von Erin Robinson und Anthony Frisby, die erkundet, wie künstliche Intelligenz unser Verständnis von Erotik, Intimität und Identität tiefgreifend verändert. Im Zentrum steht eine „autonome Begehrensmaschine“, die mithilfe rekursiver Diffusionsmodelle synthetische erotische Bilder erzeugt – Deepfakes des Künstlergesichts, gespeist von KI-Pornodaten.
Was zunächst wie klassische Pornografie erscheint, entpuppt sich als verstörend: fragmentierte Körper, unheimliche Assemblagen, physisch Unmögliches. XXX Machina dekonstruiert das Begehren – zwischen Mangel und Simulation, zwischen Fleisch und Algorithmus. Gestützt auf Lacan, Bataille und poststrukturalistische Theorie fragt die Arbeit, wie KI die Bedingungen von Sexualität verändert. Was passiert, wenn Lust unendlich abrufbar wird? Wenn Intimität zum Datensatz gerinnt? XXX Machina konfrontiert uns mit einer Zukunft, in der Begehren nicht mehr menschlich bleibt, sondern maschinell neu konfiguriert wird.
Kunst, Wissenschaft und Bildung im Dialog
Die große Festivalthemenausstellung, unterstützt von European Digital Deal und dem BMWKMS*, in den weitläufigen Katakomben der POSTCITY versammelt künstlerische Arbeiten, die die Rolle von Kunst in Zeiten des Umbruchs sichtbar machen und kritisch reflektieren.
Calin Segals interaktive Installation Whispers untersucht, wie algorithmisch kuratierte Inhalte und digitale Diskurse Identitäten beeinflussen. In The Falling City entwickeln Noemi Iglesias Barrios, Radix – Knowledge Centre Data and Society und die Liga für Menschenrechte ein künstlerisches AI-Überwachungssystem, das nicht nach Aggression, sondern nach Liebe im öffentlichen Raum Brüssels sucht. Mit Dystopia Land präsentieren Etsuko Ichihara und die Civic Creative Base Tokyo (CCBT) ein partizipatives Ausstellungsprojekt, das ein dystopisches Paralleluniversum entwirft, um über alternative Zukünfte, Lebensweisen und kollektive Resilienz nachzudenken.

Ebenfalls in der POSTCITY zeigt das Ars Electronica Futurelab mit Corpus Corax eine spekulative, interaktive Erfahrung, die Besucher*innen in die Kommunikation von Raben eintauchen lässt. Basierend auf alltäglichen Interaktionsszenarien wie einem Gespräch beim Abendessen erforscht das Projekt ungewöhnliche Formen der Verständigung zwischen Spezies. Der Human-Raven Translator (HuRT) experimentiert mit Echtzeitübersetzung von Rabenlauten, gestützt auf Daten des Konrad-Lorenz-Forschungszentrums. Dabei stellt Corpus Corax grundlegende Fragen zu Sprache, Intelligenz und menschlicher Wahrnehmung.
Seit über zwei Jahrzehnten ist die Kunstuniversität Linz ein zentraler Partner von Ars Electronica. Auch 2025 zeigt sie wieder zahlreiche Arbeiten aus 14 unterschiedlichen Abteilungen. Die Projekte sind in den beiden Brückenkopfgebäuden sowie am Linzer Hauptplatz zu sehen. In der splace gallery am Hauptplatz präsentiert sich 2025 die National Academy of Art Sofia, die diesjährige Featured University. Ihre Ausstellung „/decisions/make/art“ reframt künstlerisches Schaffen als eine Logik der Wahl, der Reaktion und des systemischen Denkens. Mit interaktiven Installationen, generativen Systemen und Experimenten mit maschinellem Lernen erkunden die Studierenden, wie sich ästhetischer Ausdruck in ein ethisches Aushandlungsfeld verwandelt.
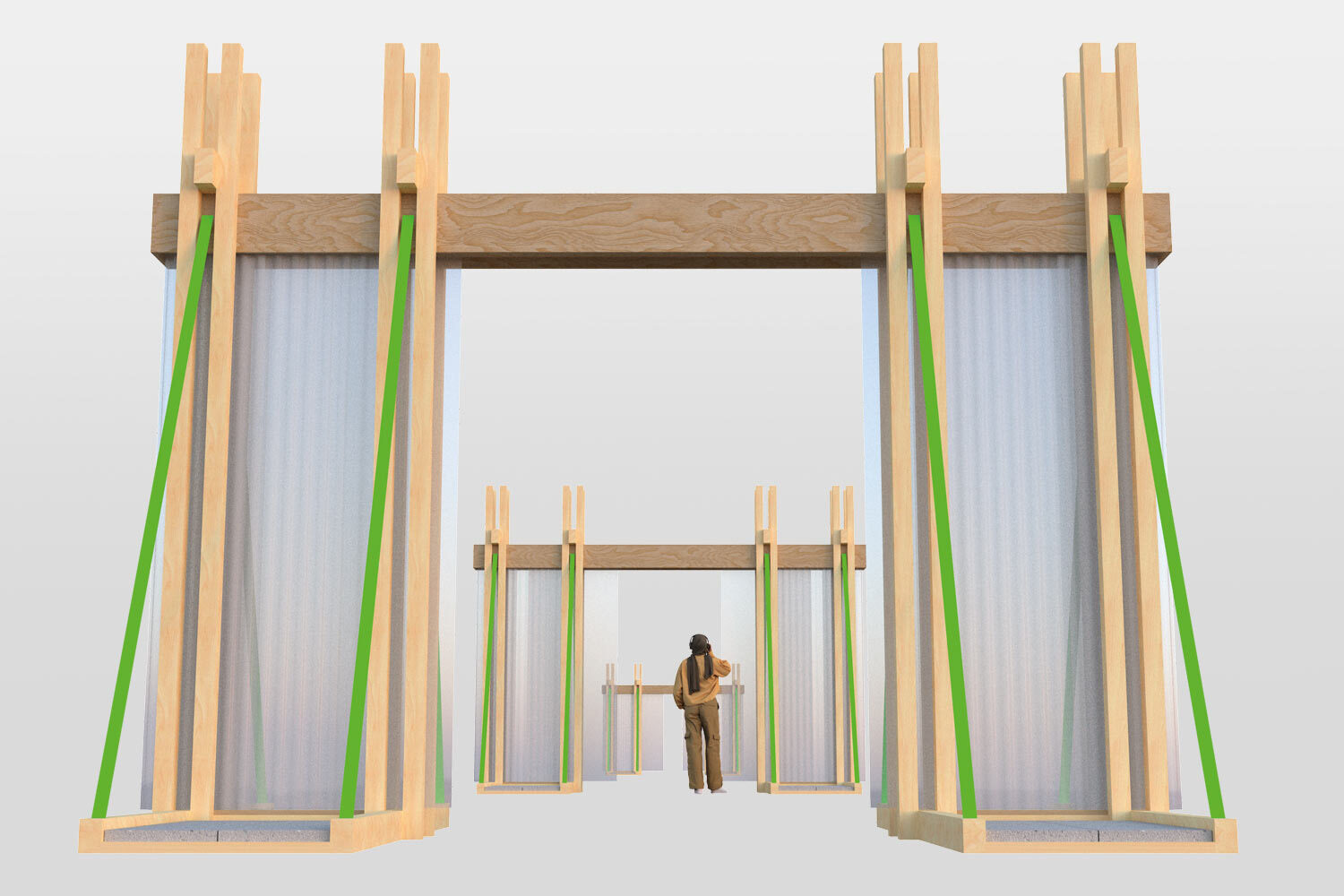
Die Campus-Ausstellung, zu sehen in der POSTCITY, thematisiert in 37 Beiträgen von Universitäten aus aller Welt die sich verändernde Rolle kreativer Bildung in einer Zeit globaler Instabilität und des ständigen Wandels. Sie reflektiert, welche Bedeutung künstlerische Lehre heute hat – und welche Verantwortung sie für die Zukunft übernimmt.
Als weiterer Beitrag im Rahmen von Campus widmet sich die Ausstellung Expanded Play den kreativen Potenzialen digitaler Spielformen. In einer Kooperation zwischen der Fachhochschule Oberösterreich, der Masaryk-Universität und der Filmakademie Baden-Württemberg werden im Salzamt künstlerische Arbeiten gezeigt, die an der Schnittstelle von Interaktion, Narration und Spielmechanik entstehen. Sie erforschen, wie sich Spielstrukturen als Ausdrucksform nutzen lassen und welche neuen Erzählräume sich daraus eröffnen.
Zwischen Politik, Panik und Perspektive
Kunst und Kultur bewegen sich im Spannungsfeld aktueller Krisen – tief eingebettet in wirtschaftliche, technologische, soziale und politische Entwicklungen. Genau darin liegt ihre besondere Stärke: Sie bieten Raum, um die Bedingungen unserer Gegenwart zu hinterfragen und ihre Veränderung mitzugestalten.
Zum 30-jährigen Jubiläum von Österreichs EU-Beitritt widmet sich eine zweitägige Konferenz, die im Rahmen des Ars-Electronica-Theme-Symposiums gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport veranstaltet wird, dem Thema „Reimagining Europe’s Future“. Im Fokus steht die Politik der Europäischen Union und die Frage, welche Rolle Kunst und Kultur bei der Gestaltung zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklungen spielen können.
Der zweite Konferenztag steht unter dem Titel „Grenzen überschreiten: Kunst und Kultur gegen Panik“. Im Mittelpunkt: die Verortung von Kunst an den Schnittstellen unterschiedlicher Disziplinen – als Ort der kollektiven und individuellen Sinnstiftung, als Medium der Übersetzung komplexer Zusammenhänge über disziplinäre Grenzen hinweg.
Untersucht wird, wie Förderprogramme der EU – etwa NEB, STARTS, EIT, Horizon oder Creative Europe – künstlerische Praktiken stärken und wie kulturelle Perspektiven wiederum politische Prozesse beeinflussen können. In anschließenden Gesprächen diskutieren Künstler*innen die politischen Dimensionen ihrer Werke: als Kommentar, Kritik oder direkte Intervention im öffentlichen Raum.
Der Nachmittag richtet den Blick auf ein weiteres zentrales Thema: die Rolle von Kunst im Umgang mit individueller Panik, psychischer Gesundheit und medizinischer Bildung. Gemeinsam mit dem Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft, EIT Health und EIT Culture & Creativity diskutieren Mediziner*innen, Künstler*innen, Forschende und politische Entscheidungsträger*innen, wie interdisziplinäre Ansätze neue Wege im Gesundheitswesen und in der medizinischen Forschung eröffnen können.
Digitaler Kompost
Digitale Daten gelten oft als immateriell und harmlos, scheinbar losgelöst von der physischen Welt. Tatsächlich jedoch basieren sie auf gewaltigen Infrastrukturen, die enorme Mengen an Energie, Wasser und Rohstoffen verbrauchen und dabei Wärme und CO₂ ausstoßen. „Computational Compost“ von Architektin und Forscherin Marina Otero Verzier reagiert auf diese unsichtbaren Auswirkungen und untersucht, wie sich der Energiebedarf digitaler Systeme umleiten lässt, um ökologische Prozesse zu unterstützen, statt sie zu belasten.

Das Projekt, das im Rahmen des S+T+ARTS Prize 2025 mit einer Honorary Mention ausgezeichnet wurde, ist Teil der S+T+ARTS Prize Exhibition „Navigating Uncertainty“**. Es präsentiert einen funktionierenden Prototyp, der die bei rechenintensiven Simulationen zur Entstehung des Universums entstehende Abwärme nutzt, um eine Wurmkompostierungsmaschine zu betreiben. In diesem System wandeln lebende Würmer und Mikroorganismen organische Abfälle in fruchtbaren Boden um – unterstützt durch die Wärme digitaler Rechenprozesse. Ergänzt wird die Installation durch einen Film über Quipu, ein altes Inka-System zur Aufzeichnung von Informationen. Gemeinsam laden diese Elemente dazu ein, sich eine Zukunft vorzustellen, in der digitale Systeme nicht zerstören, sondern regenerieren.
Politische Bilderwelten
Die Retrospektive „Patterns and Politics “ der US-amerikanischen Medienkünstlerin Claudia Hart präsentiert ein vielschichtiges Werk, das seit den 1990er-Jahren an der Schnittstelle von Technologie, Ästhetik und Gesellschaft operiert. In ihren virtuellen 3D-Szenarien verschmelzen mathematische Strukturen, naturwissenschaftliche Modelle und die visuelle Sprache der Konsumwelt zu komplexen Bildräumen – mythologisch aufgeladen, formal verdichtet und kritisch reflektiert.
Ein simuliertes Auge – die virtuelle Kamera – durchstreift diese digitalen Welten. Aus den resultierenden Rendersequenzen entstehen Filme, Installationen, Pigmentdrucke, Rapid-Prototype-Skulpturen, Quilts, Augmented-Reality-Tapeten und Gemälde. Harts künstlerisches Vokabular vereint wissenschaftliche Denkformen mit historischen Narrativen und stellt zentrale Fragen nach Wahrnehmung, Körper, Identität, Aufmerksamkeit und Macht.

Immer wieder rückt sie das Verdrängte ins Zentrum: In ihren Ghost Paintings etwa würdigt sie vergessene Künstlerinnen der Moderne oder lässt klassische Stillleben digital zerfallen, um die brüchigen Strukturen des Kunstkanons sichtbar zu machen. Ihr Werk tritt bewusst in Dialog mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Aktivistinnen, deren Beiträge als Datenströme in ihre Simulationen einfließen. So entsteht ein visuelles Geflecht, das die Mechanismen kultureller Ausgrenzung offenlegt.
Patterns and Politics verdichtet Vergangenheit, Gegenwart und mögliche Zukünfte zu einem ornamentalen, politisch aufgeladenen Bildraum. Besucher:innen sind eingeladen, den virtuellen Raum als skulpturale Erfahrung zu begreifen – und die scheinbar dekorativen Strukturen als Ausdruck gesellschaftlicher Ordnungen zu lesen.
Im Geiste von Ars Electronica zeigt auch diese Retrospektive: Kunst ist nicht nur Ausdruck, sondern Haltung. „Art is not a thing, but a way“, wie Elbert Hubbard schrieb – und Claudia Harts Werk ist genau das: ein künstlerischer Weg durch das digitale Zeitalter.
Das Ars Electronica Festival findet von 3. bis 7. September 2025 unter dem Thema „PANIC – yes/no“ in Linz statt. Weitere Informationen zum Festival gibt es auf unserer Website. Einen Überblick über weitere Highlights des Programms findest du hier. Noch mehr spannende Einblicke, Hintergrundgeschichten und Gespräche mit Künstler*innen gibt es in unserem Festival-Podcast.
*The Theme Exhibition is presented in the context of European Digital Deal. European Digital Deal is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and by the Austrian Federal Ministry for Housing, Arts, Culture, Media and Sport.
**STARTS is funded by the European Union under the Grant Agreement No 101135691.
